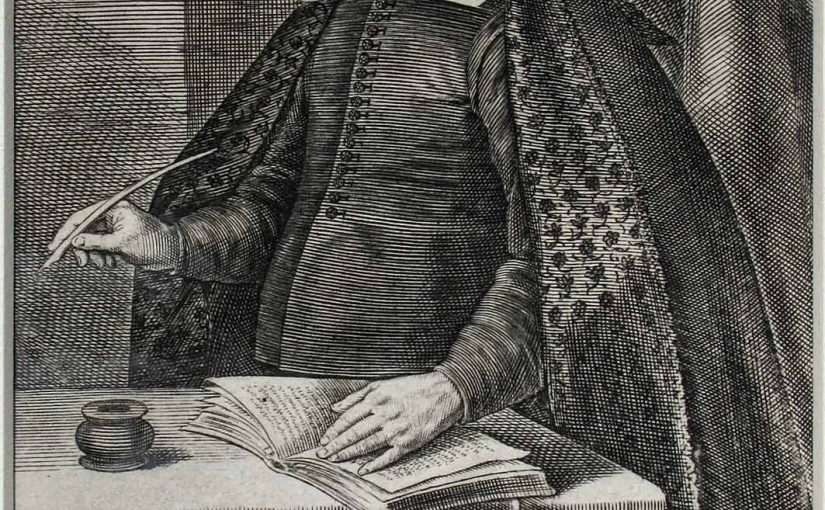Mit dem Leben der Anna Neumann ist in eigenartiger Weise das Leben eines Pfarrersohnes und Reiseschriftstellers verbunden. Die Herrschaft Murau hatte das Vogtei recht über die Pfarre Ranten, die eigentlich unter kirchlichem Patronat stand. Um 1553 wurde dort ein Lungauer Bauernsohn als Pfarrer eingesetzt, der ordentlich zum Priester geweiht war, freilich vorher in Zwickau und Wittenberg studiert hatte: Martin Zeiller d. Ä. Er bekannte sich einige Jahre später offiziell zum evangelischen Glauben, heiratete auch und blieb bis zu seiner Vertreibung im Jahre 1600, also fast durch fünf Jahrzehnte, Pfarrer in Ranten. Seiner Anregung werden die bedeutenden Fresken verdankt, die die Außenseite der dortigen Kirche schmücken und die in eindeutiger Weise die Gesetz- und Evangeliumsdarstellung, den leidenden Hiob und Christus als Weltenrichter zeigen.
Aus der dritten Ehe des älteren Martin Zeiller entstammt der gleichnamige Sohn, der 1589 geboren wurde. Mit dem Vater hatte er die Heimat zu verlassen. Er besuchte dann in Ulm die Schule, wohin sein Vater etwas später gelangte. Der ältere Zeiller fand nämlich nach langen Mühen in Ulm eine Ausstellung als Pestseelsorger und ist dann im Jahr 1609 dort verstorben. In der Zwischenzeit ist der Sohn zum Studium nach Wittenberg gegangen. Nach Beendigung des Studiums schlug er jenen Weg ein, den damals viele Theologen nahmen, er wurde Erzieher adeliger Söhne.
Dabei war es für ihn bezeichnend, daß er ausschließlich Söhne österreichischer Adeliger als Mentor und Hofmeister begleitete. Für den steirischen Adel war es zunächst wichtig, daß die Söhne von evangelischen Adeligen an evangelischen Universitäten und in evangelische Länder begleitet wurden. So war die Sorge des Martin Zeiller auch dadurch gekennzeichnet, seinen Schützlingen eine angemessene evangelische Ausbildung zu geben bzw. zu verschaffen. Auf diese Weise kam er aber in viele Gegenden und Länder Deutschlands; später, als seine Schützlinge katholisch geworden waren, weil man in ihrer Heimat als evangelischer Adeliger nicht mehr bleiben konnte, gelangte er auch nach Italien.
Es war eine lange Zeit, während der er diese Reise machte. Nur langsam vermochte er dafür Sorge zu tragen, daß er in Ulm seine Heimat finden konnte. Er war schon vierzig Jahre alt, als ihm dies endlich gelang. 1629 kaufte er dort ein Haus, wurde Bürger der Stadt und konnte im Jahr 1630 eine Bürgerswitwe heiraten. Die Ehe blieb freilich kinderlos.
Nun versuchte er in den Dienst der Stadt Ulm zu treten, sei es als Prediger, sei es und das war wohl eher seine Absicht, als Schulmeister. Beides gelang ihm vorerst nicht. So begann er die Reiseerlebnisse, die er hatte, in einem Buch zu schildern. Dieses Reisebuch, das anscheinend einem dringenden Bedürfnis der Zeit entsprochen hat, fand begeisterte Aufnahme. Damit waren aber der weitere Lebensweg und die Tätigkeit von Martin Zeiller bestimmt: Er wurde zum erfolgreichsten Reiseschriftsteller des 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum.
Man muß sich vorstellen, daß dies mitten im 30jährigen Krieg vor sich ging. Zeiller selbst hatte wegen seiner Hofmeistertätigkeit nur zum Teil von den Kriegswirren unmittelbar Kenntnis. Und auch die Stadt Ulm war infolge ihrer hervorragend instand gehaltenen Befestigungen von den Schrecken des Krieges unmittelbar verschont geblieben, obschon sich dieser, gerade in den Jahren nach der Niederlassung von Zeiller in ihr, im südwestdeutschen Raum konzentriert hatte.
Vielleicht waren es gerade diese Schrecknisse des Krieges, die Menschen dazu begeisterten, Reisebücher zu lesen, und zwar auch über Orte, wo sie selbst nicht hinkommen konnten. Nachdem Zeiller seine eigenen Reisen ausgewertet hatte, dem deutschen Reisebuch folgte eine Reisebeschreibung durch Frankreich, eine durch England, eine durch Spanien und eine durch Italien, nahm er es auf sich, Reisen anderer zu beschreiben, die ihm das Material dafür zur Verfügung stellten. Den Abschluß dieser Reisebeschreibungen stellte aber eindeutig jenes Handbuch für Reisende dar, in dem Zeiller in systematischer Weise Ratschläge für Reisende aus seiner eigenen Erfahrung zusammenstellte. Daß das ebenfalls einem Bedürfnis, nicht zuletzt nach dem Ende des 30jährigen Krieges, entsprochen hat, beweist die Tatsache, daß sein „fidus Achates oder getreuer Reisgefährt“ schon 1680 zum dritten Mal aufgelegt worden ist. Durch diese Reisebeschreibungen wurde der Frankfurter Kupferstecher und Verleger Matthias Merian auf Zeiller aufmerksam. Er gewann ihn dafür, daß Zeiller die Texte für die von Merian zusammengestellten und herausgegebenen Ländertopographien verfaßte. Und damit hat Zeiller den Bereich der bloßen Reiseschriftstellerei weitaus verlassen und hat in einer für die damalige Zeit geradezu unbegreiflichen Sorgfalt und Genauigkeit weite Teile Europas beschrieben, also landeskundliche Darstellungen geliefert. Der Wert der Merianschen Topographiebände lag zu einem hohen Maße bei den Beschreibungen, die Zeiller dazu geliefert hat, auch wenn sein Name erst nach dem Tod von Matthias Merian auf den Titelblättern genannt wurde.
Daneben betrieb Zeiller auch Übersetzungstätigkeit und schrieb literarische Werke verschiedenen Inhaltes.
In Ulm selbst brachte er es zu Ansehen, wurde Mitglied der städtischen Zensurbehörde, Aufsichtsorgan über die städtischen Schulen und nahm andere Ämter in der Stadtverwaltung wahr. So blieb er sein ganzes Leben lang Schriftsteller und hatte damit sein Auskommen.
Religiöse Hinweise finden sich in seinen Schriften nur wenige. Vielleicht war es die Erfahrung der verschiedenen Konfessionen, die ihn vorsichtig machten? Andererseits hat er aber das Angebot, doch auch katholisch zu werden, wie es zwei seiner Schützlinge geworden sind, einfach abgelehnt, und er lebte und webte ganz bewußt aus biblischem Geiste. Vielleicht war es seine irenische Natur, die ihn dazu bewogen hat, Positives aus jeder Konfession aufzunehmen und zu akzeptieren.
So war er wohl nicht unmittelbar ein Zeuge des Evangeliums, mittelbar aber wohl. Er hat vorgeschlagen, daß nach seinem Tod die Grabpredigt über das Wort aus dem 1. Buch Mose 32, 10 gehalten wurde: „Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die Du an Deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr, denn diesen Stab, da ich über den Jordan ging, und nun bin ich zwei Heere geworden“.
Der Exulantenjunge Zeiller, dessen Vater von Anna Neumann, so gut es ging und so lange es möglich war, gegen die andrängende Gegenreformation geschützt worden war, war kein Eiferer im Sinne evangelischer Engherzigkeit, sondern verkörperte wohl jene Offenheit, die dem evangelischen Bekenntnis gerade im Blick auf die Toleranz auch innewohnt.
Gustav Reingrabner: Eine Wolke von Zeugen Aus: Glaube und Heimat 1993, S.39-41.